Social Media Beitrag vom 07.04.2025: Link zum Instagram-Post
Sie engagierte sich durch vier politische Systeme hindurch für die Rechte von Frauen und Kindern: Geboren wurde Maria Johanna Baum am 23. März 1874 in Danzig. Am 8. August 1964 starb sie mit 90 Jahren in ihrer Wahlheimat Heidelberg.

Dank ihrer Mutter Flora Baum, selbst Frauenrechtlerin und Leiterin des Leipziger Vereins Frauenwohl, konnte sie in Zürich das Abitur ablegen und Naturwissenschaften studieren. Das Leid der jungen Fabrikarbeiterinnen brachte die promovierte Chemikerin dazu, anstelle einer Industriekarriere eine Arbeit in der Fürsorge anzunehmen. Ihr Engagement führte sie in die Politik und vielfältige Ämter. So leitete sie ab 1917 die in Hamburg von ihr und Gertrud Bäumer neu gegründete Soziale Frauenschule und das Sozialpädagogisches Institut.
Nach dem 1. Weltkrieg vertrat Marie Baum von 1919 bis 1921 die Deutsche Demokratische Partei (DDP) in der Weimarer Nationalversammlung und zog dann als Abgeordnete in den Reichstag ein. Wiederum zugunsten der Kinder- und Jugendfürsorge verzichtete sie auf eine erneute Kandidatur und widmete sich im badischen Staatsministerium dem Aufbau eines staatlichen Fürsorgewesens. Außerdem nahm sie Lehraufträge an der Universität Heidelberg wahr, publizierte und gründete – gemeinsam mit anderen namhaften Frauenrechtlerinnen – die Deutsche Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit.
Die Nationalsozialisten entzogen ihr 1933 das Recht zu arbeiten und damit die Existenzgrundlage, da Baum nach den nationalsozialistischen Rassenbestimmungen mit einem jüdischen Großelternteil als „Mischling“ galt. Es war die Dichterin Ricarda Huch, die ihr aus der Notlage half und sie dazu motivierte, sich schreibend weiterhin für Frauen- und Kindeswohl einzusetzen.
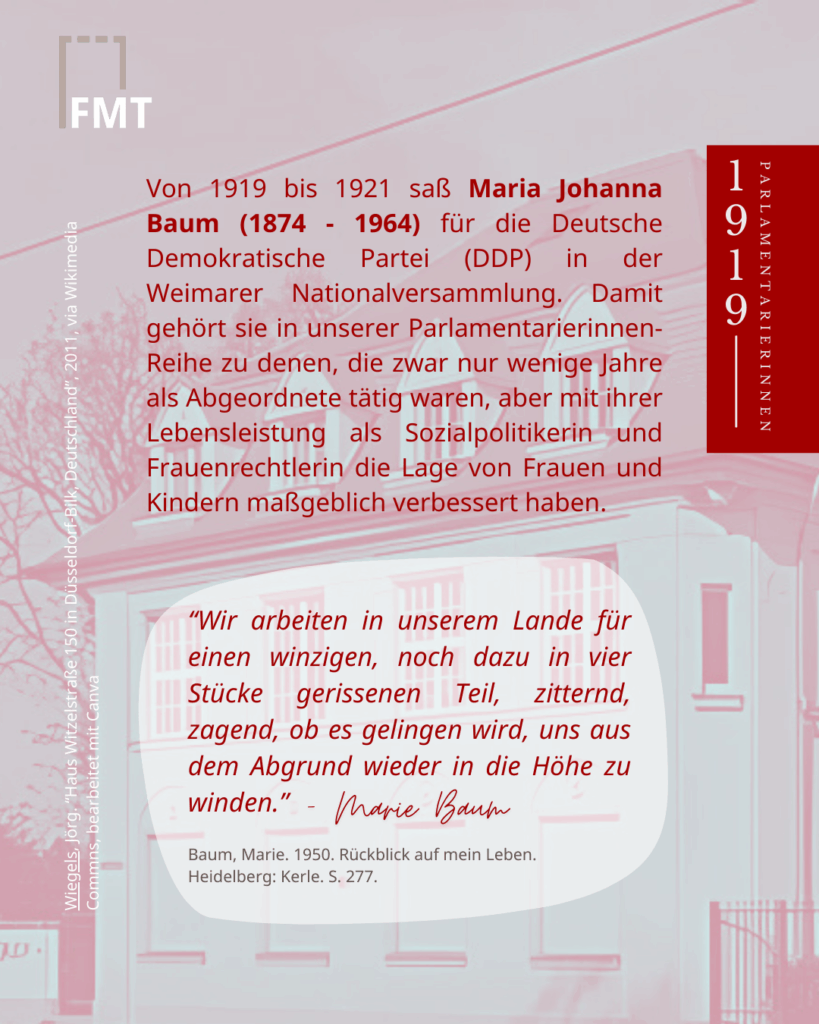
Als Mitarbeiterin einer „Hilfsstelle für bedrohte Nichtarier“ (Lauterer, Parlamentarierinnen, S. 225) beschaffte sie ab 1935 Lebensmittel und Fluchtdokumente für jüdische Menschen. Über ihren Einsatz geben ausschließlich autobiografische Notizen und Briefe Auskunft; alle Unterlagen wurden bei einer Gestapo-Hausdurchsuchung 1941 konfisziert. Nach dem Krieg nahm sie – über 70-jährig – wieder Lehraufträge wahr und engagierte sich auch weiterhin sozialpolitisch.
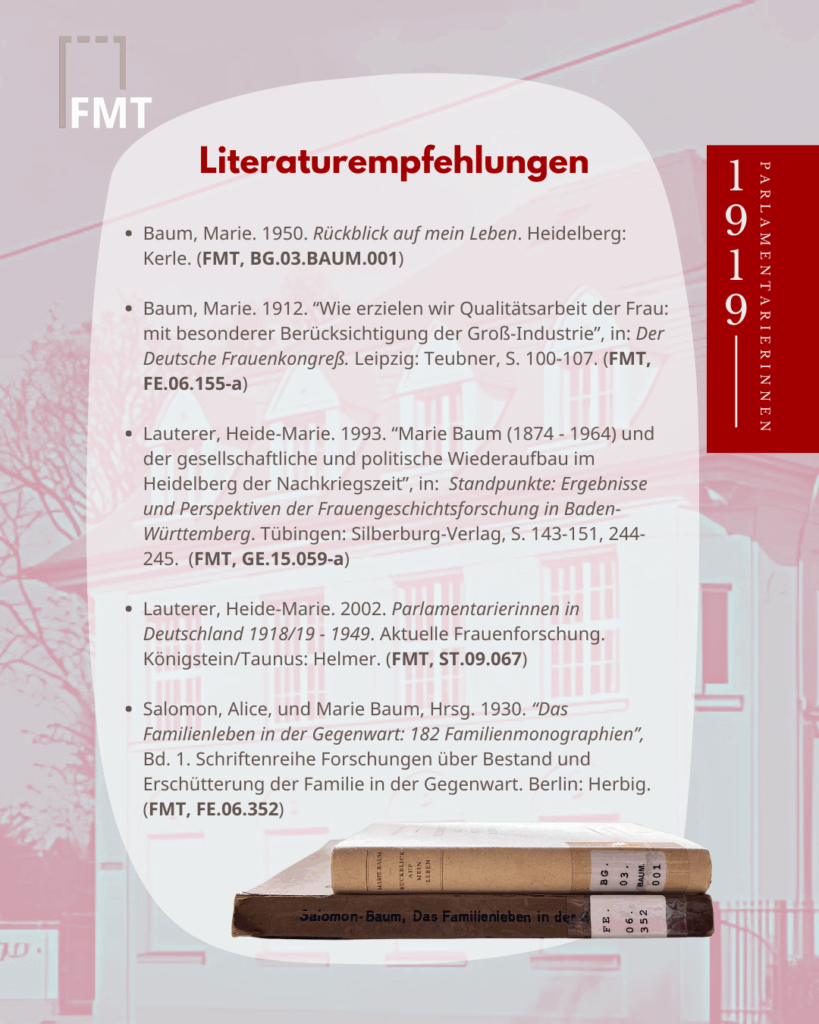
07.04.2025


